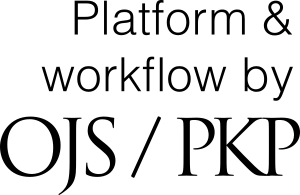Hypermediacy in Self-Presentations in Social Media: Explorations of a Case of Threatened Subjectivity
DOI:
https://doi.org/10.17169/fqs-26.2.4426Keywords:
hypermediacy, self-presentation, Social Media, the connection between narrative and pictorial biographies, image cluster analysis, biographical case reconstructionAbstract
Acting with images in social media is partly linked to practices using analog photographs. At the same time, new forms of image creation have emerged that increasingly depart from the representational function of photography. It is no longer just a matter of capturing reality and creating cues for memories. Rather, ways of expression are being explored in digital space, in which the reference to an extra-medial reality not only becomes more complicated, but also seems to get lost in numerous chains of reference. During a person's self-presentation in social media, through the compilation of primarily documentary photographs on the one hand, and highly staged, often modified, sometimes confusing and shocking images on the other, complex contexts of meaning emerge. Based on a case analysis from a biographical-analytical perspective, I examine the question as to whether such modes of self-presentation can be understood with a concept of hypermediacy. By means of image cluster analyses and biographical case reconstruction using a narrative-biographical interview, I reconstruct to what extent hyper-mediated image environments can be understood not only as pure play with images, but also as references to extra-pictorial biographical contexts. From the case-analysis, I will conclude generalizable aspects of the social function of hyper-mediated self-presentations.
Downloads
References
Alheit, Peter (1990). Alltag und Biographie: Studien zur gesellschaftlichen Konstitution biographischer Perspektiven. Bremen: Universität Bremen.
Ayaß, Ruth (2022). Interaktion und (digitale) Medien. In Karl Lenz & Robert Hettlage (Hrsg.), Goffman-Handbuch: Leben – Werk – Wirkung (S.451-459). Stuttgart: J.B. Metzler.
Barthes, Roland (1989 [1980]). Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Belting, Hans (2001). Bild-Anthropologie. Entwürfe für eine Bildwissenschaft. München: Fink.
Belting, Hans (2007). Bilderfragen. Die Bildwissenschaften im Aufbruch. München: Fink.
Benjamin, Walter (1977). Das Kunstwerkt im Zeichen der technischen Reproduzierbarkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Blank, Stefan (2004). Martin Seel – Medialität und Welterschließung. In Alice Lagaay & David Lauer (Hrsg.), Medien-Theorien. Eine philosophische Einführung (S.249-273). Frankfurt/M.: Campus.
Boehm, Gottfried (1995). Die Wiederkehr der Bilder. In Gottfried Böhm (Hrsg.), Was ist ein Bild? (S.11-38). München: Fink.
Boehm, Gottfried (2007). Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens. Berlin: Berlin University Press.
Böhme, Gernot (1999). Theorie des Bildes. München: Fink.
Bolter, J. David & Grusin, Richard A. (1999). Remediation: Understanding new media. Cambridge, MA: MIT Press.
Bourdieu, Pierre; Boltanski, Luc; Castel, Robert; Chamboredon, Jean-Claude; Lagneau, Gérard & Schnapper, Dominique (1983 [1965]). Eine illegitime Kunst. Die sozialen Gebrauchsweisen der Photographie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Breckner, Roswitha (2010). Sozialtheorie des Bildes. Zur interpretativen Analyse von Bildern und Fotografien. Bielefeld: transcript.
Breckner, Roswitha (2012). Bildwahrnehmung – Bildinterpretation. Segmentanalyse als methodischer Zugang zur Erschließung bildlichen Sinns. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 37(2), 143-164.
Breckner, Roswitha (2013). Bild und Biographie – ein Kaleidoskop von Selbstbildern?. In Carsten Heinze & Alfred Hornung (Hrsg.), Medialisierungsformen des (Auto-)Biographischen (S.159-180). Konstanz: UVK.
Breckner, Roswitha (2015). Biography and society. In James D. Wright (Hrsg.), The international encyclopedia of the social & behavioral sciences (S.637-643). Oxford: Elsevier.
Breckner, Roswitha (2017). Zwischen Leben und Bild. Zum biografischen Umgang mit Fotografien. In Thomas S. Eberle (Hrsg.), Fotografie und Gesellschaft. Phänomenologische und wissenssoziologische Perspektiven (S.229-239). Bielefeld: transcript.
Breckner, Roswitha (2018). Denkräume im Bildhandeln auf Facebook. Ein Fallbeispiel in biographieanalytischer Perspektive. In Michael R. Müller & Hans Georg Soeffner (Hrsg.), Das Bild als soziologisches Problem. Herausforderungen einer Theorie visueller Sozialkommunikation (S.70-94). Weinheim: Beltz Juventa.
Breckner, Roswitha (2021). Iconic mental spaces in social media. A methodological approach to analysing visual biographies. In Roswitha Breckner, Karin Liebhart & Maria Pohn-Lauggas (Hrsg.), Sozialwissenschaftliche Analysen von Bild- und Medienwelten (S.3-31). Berlin: De Gruyter Oldenbourg.
Breckner, Roswitha (2025/in Vorbereitung). Biografien in vernetzten Lebenswelten. Soziale Medien als Imaginationsraum der Selbst-Gestaltung (Arbeitstitel). Wien: Böhlau.
Breckner, Roswitha & Mayer, Elisabeth (2023). Social media as a means of visual biographical performance and biographical work. Current Sociology, 71(4), 661-682, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00113921221132518 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Bredekamp, Horst (2010). Theorie des Bildakts. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Cassirer, Ernst (1994a [1942]). Zur Logik der Kulturwissenschaften. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Cassirer, Ernst (1994b [1954]). Philosophie der symbolischen Formen. Dritter Teil: Phänomenologie der Erkenntnis. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Chalfen, Richard (1987). Snapshot versions of life. Bowling Green, OH: Bowling Green State University Popular Press.
Didi-Huberman, Georges (1999 [1997]). Ähnlichkeit und Berührung. Archäologie, Anachronismus und Modernität des Abdrucks. Köln: DuMont.
Fischer, Wolfram & Kohli, Martin (1987). Biographieforschung. In Wolfgang Voges (Hrsg.), Methoden der Biographie- und Lebenslaufforschung (S.25-49). Opladen: Leske + Budrich.
Fischer-Rosenthal, Wolfram (1995). The problem with identity: Biography as solution to some (post)-modernist dilemmas. Comenius, 15, 250-265.
Fischer-Rosenthal, Wolfram & Rosenthal, Gabriele (1997). Warum Biographieanalyse und wie man sie macht. Zeitschrift Für Sozialisationsforschung und Erziehungssoziologie (ZSE), 17(4), 405-427.
Flick, Uwe (2011). Triangulation. Eine Einführung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Foucault, Michel (1983 [1973]). Dies ist keine Pfeife. Berlin: Ullstein.
Frosh, Paul (2015). The gestural image: The selfie, photography theory, and kinesthetic sociability. International Journal of Communication, 9, 1607-1628, https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/3146/1388 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Frosh, Paul (2019). The poetics of digital media. Cambridge: Polity Press.
Glaser, Barney G. & Strauss, Anselm L. (1967). The discovery of grounded theory. Chicago, IL: Aldine.
Goffman, Erving (1981 [1979]). Geschlecht und Werbung. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Gurwitsch, Aron (1975 [1957]). Das Bewusstseinsfeld. Einleitung. In Carl F. Graumann & Alexandre Métraux (Hrsg.), Phänomenologisch-Psychologische Forschungen (S.1-12). Berlin: Walter de Gruyter.
Hahn, Alois (1982). Zur Soziologie der Beichte und anderer Formen institutionalisierter Bekenntnisse. Selbstthematisierung und Zivilisationsprozess. Kölner Zeitschrift Für Soziologie und Sozialpsychologie, 34, 407-434.
Hahn, Alois (2000). Konstruktionen des Selbst, der Welt und der Geschichte. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Hirsch, Marianne (2002). Family frames. Photography, narrative, and postmemory. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hogan, Bernie (2010). The presentation of self in the age of social media. Distinguishing performances and exhibitions online. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(6), 377-386.
Imdahl, Max (1995). Ikonik. Bilder und ihre Anschauung. In Gottfried Boehm (Hrsg.), Was ist ein Bild? (S.300-324). München: Fink.
Imdahl, Max (1996 [1980]). Giotto, Arenafresken. Ikonographie, Ikonologie, Ikonik. München: Fink.
Inowlocki, Lena & Lutz, Helma (2000). Hard labour. The "biographical work" of a Turkish migrant woman in Germany. The European Journal of Women's Studies, 7(3), 301-319.
Kelle, Udo & Kluge, Susanne (2010). Vom Einzelfall zum Typus. Fallvergleich und Fallkontrastierung in der qualitativen Forschung. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kentridge, William (2012). Six drawing lessons. Aufzeichnungen von sechs Norton Lectures, Mahindra Humanities Center, Universität Harvard, MA, USA, https://www.youtube.com/watch?v=cdKkmSqYTE8 [Datum des Zugriffs: 5. April 2025).
Kentridge, William (2016 [2014]). Sechs Zeichenstunden. Köln: Walther König.
Kohli, Martin (1981). Zur Theorie der biographischen Selbst- und Fremdthematisierung. In Joachim Matthes (Hrsg.), Lebenswelt und soziale Probleme: Verhandlungen des 20. Deutschen Soziologentages zu Bremen 1980 (S.502-520). Frankfurt/M.: Campus.
Kohli, Martin (1988). Normalbiographie und Individualität: Zur institutionellen Dynamik des gegenwärtigen Lebenslaufregimes. In Hanns-Georg Brose & Bruno Hildenbrand (Hrsg.), Vom Ende des Individuums zur Individualität ohne Ende (S.33-53). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
Kohli, Martin (2007). The institutionalization of the life course: Looking back to look ahead. Research in Human Development, 4, 253-271.
Krämer, Sybille (2008). Medium, Bote, Übertragung. Kleine Metaphysik der Medialität. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Krämer, Sybille (2010). Medien zwischen Transparenz und Opazität. Reflexionen über eine medienkritische Epistemologie im Ausgang von der Karte. In Markus Rautzenberg & Andreas Wolfsteiner (Hrsg.), Hide and Seek. Das Spiel von Transparenz und Opazität (S.215-225). München: Fink.
Kramer, Anke & Pelz, Annegret (Hrsg.) (2013). Album. Organisationsform narrativer Kohärenz. Göttingen: Wallstein Verlag.
Kuhn, Annette & McAllister, Kirsten Emiko (Hrsg.) (2008). Locating memory. Photographic acts. New York, NY: Berghahn Books.
Lacan, Jacques (2016 [1966]). Das Spiegelstadium als Gestalter der Funktion des Ichs. In Jacques Lacan, Schriften Band I (S.109-117). Wien: Turia+Kant.
Lagaay, Alice & Lauer, David (Hrsg.) (2004). Medientheorien. Eine philosophische Einführung. Frankfurt/M.: Campus.
Langer, Susanne K. (1984 [1942]). Philosophie auf neuem Wege. Das Symbol im Denken, im Ritus und in der Kunst. Frankfurt/M.: Fischer.
McLuhan, Marshall & Fiore, Quentin (1967). The medium is the message. Harmondsworth: Gingko press.
Meister, Moritz; Pritz, Sarah Miriam; Przyborski, Aglaja & Slunecko, Thomas (2025) Subjektfiguren der Gefühlsvermessung: zur Bildlichkeit von Mood-Tracking-Apps. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 26(2), Art. 9, https://doi.org/10.17169/fqs-26.2.4394.
Merleau-Ponty, Maurice (1984 [1961]). Das Auge und der Geist. In Hans Werner Arndt (Hrsg.), Das Auge und der Geist. Philosophische Essays (S.275-317). Hamburg: Felix Meiner Verlag.
Mersch, Dieter (2006). Medientheorien zur Einführung. Hamburg: Junius.
Mirzoeff, Nicholas (2002). The subject of visual culture. In Nicholas Mirzoeff (Hrsg) The visual culture reader (2. Aufl., S.3-23). New York, NY: Routledge.
Mitchell, William J.T. (2008). Bildtheorie. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Müller, Michael R. (2002). The Body Electric. Das Problem autonomer Lebensführung und die kollektive Sehnsucht nach Selbstverlust. In Michael R. Müller, Thilo Raufer & Darius Zifonun (Hrsg.), Der Sinn der Politik. Beiträge zur kulturwissenschaftlichen Politikanalyse (S.77-104). Konstanz: UVK.
Müller, Michael R. (2009). Stil und Individualität. Die Ästhetik gesellschaftlicher Selbstbehauptung. München: Fink.
Müller, Michael R. (2012). Figurative Hermeneutik: Zur methodologischen Konzeption einer Wissenssoziologie des Bildes. Sozialer Sinn: Zeitschrift für Hermeneutische Sozialforschung, 13(1), 129-161.
Müller, Michael R. (2016). Bildcluster. Zur Hermeneutik einer veränderten sozialen Gebrauchsweise der Fotografie. Sozialer Sinn. Zeitschrift für Hermeneutische Sozialforschung, 17(1), 95-142.
Müller, Michael R. (2018). Soziale Anschauung in technisierten Umgebungen. Die Fotografie als Medium visueller Sozialkommunikation. In Michael R. Müller & Hans-Georg Soeffner (Hrsg.), Das Bild als soziologisches Problem. Herausforderungen einer Theorie visueller Sozialkommunikation (S.95-115). Weinheim: Beltz Juventa.
Müller, Michael R. (2020). Image clusters. A hermeneutical perspective on changes to a social function of photography. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 21(2), Art. 4, https://doi.org/10.17169/fqs-21.2.3293 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Müller, Michael R. (2025a/im Erscheinen). Komplexe Bildphänomene. Wiesbaden: Springer VS.
Müller, Michael R. (2025b). Visuelle Idiome. Bebilderungen des sozialen Lebens [60 Absätze]. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 26(2), Art. 31, https://doi.org/10.17169/fqs-26.2.4444.
Nassehi, Armin (1994). Die Form der Biographie. Theoretische Überlegungen zur Biographieforschung in methodologischer Absicht. BIOS. Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History, 7(1), 46-63, https://budrich-journals.de/index.php/bios/article/view/38124/32401 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Oevermann, Ulrich (1983). Zur Sache. Die Bedeutung von Adornos methodologischem Selbstverständnis für die Begründung einer materialen soziologischen Strukturanalyse. In Ludwig Friedenburg & Jürgen Habermas (Hrsg.), Adorno-Konferenz 1983 (S.234-289). Frankfurt/M.: Suhrkamp.
Pohn-Lauggas, Maria (2016). In Worten erinnern, in Bildern sprechen. Zum Unterschied zwischen visuellen und mündlichen Erinnerungspraktiken. ZQF – Zeitschrift für Qualitative Forschung, 17(1-2), 59-80, https://budrich-journals.de/index.php/zqf/article/view/25543/22334 [Datum des Zugriffs: 18. April 2025].
Raab, Jürgen (2010). Die theatrale Präsentation der Macht. Über die Inszenierung politischen Handelns in den audiovisuellen Medien. In Ulrike Landfester & Caroline Pross (Hrsg.), Theatermedien. Theater als Medium – Medien des Theaters, Facetten der Medienkultur (S.165-188). Bern: Haupt.
Raab, Jürgen (2012). Visuelle Wissenssoziologie der Fotografie. Sozialwissenschaftliche Analysearbeit zwischen Einzelbild, Bildkontexten und Sozialmilieu. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 37(2), 121-142.
Raab, Jürgen; Egli, Martina & Stanisavljevic, Marija (2010). Purity and Danger 2.0. Grenzüberschreitungen und Grenzziehungen der Internetpornographie. In Jörg Metelmann (Hrsg.), Porno-Pop II. Im Erregungsdispositiv (S.191-210). Würzburg: Königshausen & Neumann.
Riemann, Gerhard (2003). A joint project against the backdrop of a research tradition: An introduction to "doing biographical research". Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 4(3), Art. 18, https://doi.org/10.17169/fqs-4.3.666 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Riemann, Gerhard & Schütze, Fritz (1990). Trajectory as a basic theoretical concept for analyzing suffering and disorderly social processes. In David R. Maines (Hrsg.), Social organization and social processes (S.333-357). Hawthorne, NY: Aldine.
Rose, Gillian (2010). Doing family photography. The domestic, the public and the poliltics of sentiment. Farnham: Ashgate.
Rosenthal, Gabriele (1995). Erlebte und erzählte Lebensgeschichte: Gestalt und Struktur biographischer Selbstbeschreibungen. Frankfurt/M.: Campus.
Rosenthal, Gabriele (2004). Biographical research. In Clive Seale, Giampietro Gobo, Jaber F Gubrium & David Silverman (Hrsg.), Qualitative research practice (S.48-64). London: Sage, https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-56725 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Schreiber, Maria (2015). Freundschaftsbilder – Bilder von Freundschaft. Zur körperlich-ikonischen Konstitution von dyadischen Beziehungen in Fotografien. In Ralf Bohnsack, Burkard Michel & Aglaja Przyborski (Hrsg.), Dokumentarische Bildinterpretation. Methodologie und Forschungspraxis (S.241-260). Opladen: Barbara Budrich.
Schreiber, Maria (2020). Digitale Bildpraktiken. Handlungsdimensionen visueller vernetzter Kommunikation. Wiesbaden: Springer VS.
Schreiber, Maria (2023). #strokesurvivor on Instagram: Conjunctive experiences of adapting to disability. MedieKultur. Journal of Media and Communication Research, 39(74), 50-72, https://tidsskrift.dk/mediekultur/article/view/132468/181725 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Schreiber, Maria (2024a). Text on Instagram as emerging genre: A framework for analyzing discursive communication on a visual platform. Studies in Communication Sciences, 24(1), 141-157, https://www.hope.uzh.ch/scoms/article/view/3882/3472 [Datum des Zugriffs: 27. März 2025].
Schreiber, Maria (2024b). "I started the day iust crying for 2 hours straight": Bewältigung von Krankheitserfahrung auf Instagram". In Bettina Völter, Michael R. Müller & Lena Inowlocki (Hrsg.), Bild und Biographie (S.215-226). Opladen: Barbara Budrich.
Schütz, Alfred (1971 [1962]). Symbol, Wirklichkeit und Gesellschaft. In Alfred Schütz. Gesammelte Aufsätze, Bd 1. Das Problem der sozialen Wirklichkeit (S.237-411). Den Haag: Martinus Nijhoff.
Schütze, Fritz (1981). Prozeßstrukturen des Lebensablaufs. In Joachim Matthes, Arno Pfeiffenberger & Manfred Stosberg (Hrsg.), Biographie in handlungswissenschaftlicher Perspektive (S.67-156). Nürnberg: Verlag der Nürnberger Forschungsvereinigung.
Schütze, Fritz (1983). Biographieforschung und narratives Interview. Neue Praxis, 3, 283-292, https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/5314 [Datum des Zugriffs: 18. April 2025].
Schütze, Fritz (1984). Kognitive Figuren des autobiographischen Stegreiferzählens. In Martin Kohli & Günter Robert (Hrsg.), Biographie und soziale Wirklichkeit. Neue Beiträge und Forschungsperspektiven (S.78-117). Stuttgart: Metzler, https://www.ssoar.info/ssoar/handle/document/5309 [Datum des Zugriffs: 18. April 2025].
Schütze, Fritz (1987). Das narrative Interview in Interaktionsfeldstudien: erzähltheoretische Grundlagen. Hagen: Kurs der Fernuniversität Hagen.
Schütze, Fritz (2016). Das Konzept der Sozialen Welt Teil 1: Definition und historische Wurzeln. In Michael Dick, Winfried Marotzki & Harald Mieg (Hrsg.), Handbuch Professionsentwicklung (S.74-88). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
Soeffner, Hans Georg (2020). Bild- und Sehwelten. Visueller Erkenntnisstil und Hermeneutik des Sehens. Weinheim: Beltz Juventa.
Sonnenmoser, Anne (2018). Phantasma und Illustration. Selbstdarstellung vor den Kulissen moderner Bild- und Massenmedien. Weinheim: Beltz Juventa.
Sonnenmoser, Anne (2025) Bilder-Spiele. Zur Verschränkung von virtuellem Raum und personaler Selbstdarstellung. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 26(2), Art. 31, https://doi.org/10.17169/fqs-26.2.4447.
Stanisavljevic, Marija (2016). Widerständige Kommunikation – Protest im Spannungsfeld von Massenmedien und Ästhetik. Österreichische Zeitschrift für Soziologie, 41(2), 123-148.
Strauss, Anselm L. (1993). Continual permutations of action. New York, NY: De Gruyter.
Van Dijck, José (2007). Mediated memories in the digital age. Stanford, MA: Stanford Univ. Press.
Van Dijck, José (2013). The culture of connectivity. A critical history of social media. New York, NY: Oxford University Press.
Warburg, Aby (1988). Schlangenritual. Ein Reisebericht. Berlin: Klaus Wagenbach.
Warburg, Aby (2000). Einleitung. In Martin Warnke (Hrsg.), Der Bilderatlas Mnemosyne (S.3-6). Berlin: Akademie Verlag.
Wohlrab-Sahr, Monika (1994). Vom Fall zum Typus: Die Sehnsucht nach dem "Ganzen" und dem "Eigentlichen": "Idealisierung" als biographische Konstruktion. In Angelika Dietzinger, Hedwig Kitzer, Ingrid Anker, Irma Bingel, Erika Haas & Simone Odierna (Hrsg.), Erfahrung mit Methode: Wege sozialwissenschaftlicher Frauenforschung (S.269-299). Freiburg: Kore.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Roswitha Breckner

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.